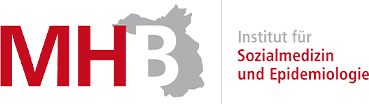International
Digitale Primärversorgung in anderen Ländern
In fünf Primärversorgungspraxen in Manitoba wurden 57 Interviews und vier Diskussionsgruppen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die EPA-Nutzungsraten auf einer Skala von 0 bis 5 zwischen 2,3 und 3,0 lagen. Besonders niedrig war die Nutzung von Entscheidungsunterstützungssystemen, der Bereitstellung von Patientenzugriff auf eigene Daten und von Praxis-Reporting-Tools. Hindernisse für die vollständige Nutzung der EPA waren unter anderem Implementierungsprobleme, unzureichende eHealth-Infrastruktur, mangelndes Bewusstsein für EPA-Funktionen und schlechte Datenqualität. Viele Ärzte nutzten ihre EPA lediglich als “elektronische Papierakten” und schöpften deren Potenzial nicht aus. Die Studie empfiehlt Bildungs- und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen, um die Datenqualität zu erhöhen und die Nutzung der EPA zu optimieren. (Price, Singer, und Kim 2013)
Die Studie “The informatics capability maturity of integrated primary care centres in Australia” untersucht, wie gut integrierte Primärversorgungszentren in Australien Informationen sammeln, verwalten und teilen sowie eHealth-Technologien implementieren. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Zentren unterschiedliche Modelle in Bezug auf Finanzierung, Eigentum, Führung und Organisation aufweisen. Der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Datensammlung und -nutzung variiert, wobei Probleme bei der Konnektivität und dem Fehlen technischer Standards die Datenintegration und -weitergabe erschweren. (Liaw u. a. 2017)
Eine Studie von Haverinen et al. untersuchte die Entwicklung der Digitalisierung in Finnland. Die größte Entwicklung der E-Health-Reife fand zwischen 2011 und 2014 statt, wobei die Entwicklung danach fortgesetzt wurde und einige Indikatoren bereits den maximalen Nutzungsgrad erreicht haben. Die primäre Gesundheitsversorgung hinkt in der Entwicklung hinter der spezialisierten Versorgung her. Es wurden regionale Unterschiede zwischen den finnischen Krankenhausbezirken festgestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass E-Health in Finnland durch nationale Strategien und gesetzliche Änderungen kontinuierlich gefördert wurde. Einige Funktionen haben bereits eine 100%-ige Nutzung erreicht, aber es besteht noch Entwicklungspotenzial, insbesondere in der primären Gesundheitsversorgung. Die Studie untersuchte die Entwicklung der E-Health-Reife in Finnland von 2011 bis 2020, sowohl im Bereich der primären Gesundheitsversorgung als auch der spezialisierten Versorgung. Daten wurden durch webbasierte Fragebögen im Rahmen von Umfragen zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie im finnischen Gesundheitswesen erhoben. Es wurden insgesamt 16 Indikatoren verwendet, die die Verfügbarkeit und Nutzung von elektronischen Patientenakten, Bildarchivierungssystemen, Gesundheitsinformationsaustausch und anderen wichtigen E-Health-Funktionen beschrieben. (Haverinen u. a. 2022)
Wie digital ist das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich?
Deutschland befindet sich laut dem Global Digital Health Monitor (GDHM, Stand Mai 2023) in Phase 5 der digitalen Gesundheit und zeigt Stärken in den Bereichen Führung und Governance, Gesetzgebung sowie Infrastruktur, mit Bewertungen von 5, insbesondere durch Datenschutz- und Datensicherheitsgesetze sowie Infrastruktur in über 75 % der Gesundheitseinrichtungen. Der private Sektor beteiligt sich systematisch an digitalen Gesundheitsaktivitäten (Score: 4), und Strategien zur Förderung von Gerechtigkeit und Menschenrechten in digitalen Gesundheitslösungen sind etabliert. Jedoch fehlen Daten für viele Indikatoren in den Bereichen Strategie und Investitionen, Arbeitskräfte, Standards und Interoperabilität sowie Dienste und Anwendungen.
Der Stand von eHealth in Deutschland hat sich laut der “2024 Digital Decade eHealth Indicator Study” im Vergleich zu 2022 deutlich verbessert. Fortschritte gibt es insbesondere in der Verfügbarkeit von elektronischen Gesundheitsakten und der Anbindung verschiedener Gesundheitsdienstleister an digitale Systeme. Dennoch bleibt der Zugang zu bestimmten Gesundheitsdaten, etwa zu medizinischen Bildern oder Daten von medizinischen Geräten, eingeschränkt. Ein weiteres Hindernis ist, dass private Gesundheitsdienstleister weniger gut vernetzt sind als öffentliche. Ambulante Einrichtungen sind weniger gut in digitale Systeme eingebunden als Krankenhäuser. Die Erhebung basiert auf einer Online-Umfrage, die von den zuständigen Behörden in jedem teilnehmenden Land ausgefüllt wird. Die Antworten spiegeln den Stand der Dinge zum 31. Dezember 2023 wider. Die Analyse erfolgt anhand von zwölf Teilindikatoren, die verschiedene Aspekte des digitalen Gesundheitswesens abdecken. Deutschland befindet sich im eHealth-Reifegrad im oberen Mittelfeld und wird als “Fast-Tracker” eingestuft. Die Umfrage zur Digitalisierung im Gesundheitswesen unterscheidet nicht explizit zwischen stationären und ambulanten Bereichen. Während größere Krankenhäuser meist an zentrale digitale Systeme angebunden sind, haben viele niedergelassene Ärzt*innen und private Einrichtungen noch keinen vollständigen digitalen Zugang. Öffentliche Krankenhäuser und Kliniken sind mit einer durchschnittlichen Vernetzungsrate von 74 % innerhalb der EU-27 besser in digitale Systeme integriert als ambulante Einrichtungen. Private Gesundheitsdienstleister, darunter viele ambulante Praxen, haben hingegen eine geringere Vernetzungsrate von nur 55 %. In Deutschland zeigt sich dieser Trend ebenfalls. (Commission u. a. 2024)
Die Bertelsmann-Studie “SmartHealthSystems: International comparison of digital strategies” untersucht die Digitalisierungsstrategien im Gesundheitswesen in 17 Ländern und zeigt, dass das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Deutschland belegt im entwickelten Digital Health Index den 16. von 17 Plätzen der untersuchten Länder. Während in anderen Ländern die wichtigsten Patientendaten in elektronischen Gesundheitsakten gespeichert und Rezepte digital übermittelt werden, arbeitet Deutschland noch an den Grundlagen digitaler Gesundheitsnetze und tauscht Informationen hauptsächlich auf Papier aus. Die Studie stellt fest, dass in Deutschland die Anwendung intelligenter Algorithmen auf theoretischer Ebene diskutiert wird, während sie in Ländern wie Israel bereits zur Krebsfrüherkennung eingesetzt werden. Im Vergleich zu Ländern wie Dänemark, Israel oder Kanada, die in allen Bereichen deutlich höhere Werte aufweisen, sind Deutschlands Bewertungen, insbesondere in der tatsächlichen Datennutzung, sehr niedrig. Deutschland zeichnet sich zudem durch strenge Datenschutzbestimmungen und das Fehlen einer übergreifenden strategischen Ausrichtung aus, wobei finanzielle Anreize für die landesweite Einführung von digitalen Lösungen fehlen. (Thiel u. a. 2019)
Die Studie „The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach“ von Jelena J. Stankovic, Ivana Marjanovic, Sasa Drezgic und Zarko Popovic schlägt eine Methodik zur Messung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Länder vor, indem sie einen zusammengesetzten Index unter Verwendung von Multi-Kriterien-Analysen (CRITIC und TOPSIS) entwickelt. Basierend auf 13 Indikatoren aus der Eurostat-Datenbank wird die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 30 europäischen Ländern bewertet, wobei nordische Länder die höchsten Werte erzielen, während osteuropäische Länder zurückliegen. Eine Cluster-Analyse zeigt zudem einen Zusammenhang zwischen digitaler Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlicher Leistung, wobei Länder mit höherer digitaler Kompetenz auch bessere wirtschaftliche Ergebnisse aufweisen. Die Studie betont die Bedeutung der IKT-Nutzung in Unternehmen und liefert Entscheidungsträgern wertvolle Einblicke für die strategische Planung der digitalen Zukunft. (Stankovic u. a. 2021)
Die Studie „SmartHealthSystems“ beleuchtet den Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen in einem internationalen Vergleich. Die Studie entwickelte einen neuartigen Digital Health Index, der den Digitalisierungsgrad in nationalen Gesundheitssystemen anhand von 34 Indikatoren aus den Bereichen Strategie, technische Bereitschaft und tatsächliche Nutzung bewertet. Im internationalen Vergleich von 17 untersuchten Ländern belegt Deutschland den 16. Platz und hinkt somit in Bezug auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen weit hinterher. Ziel der Studie ist es, Deutschland Impulse zur Vertiefung und Beschleunigung der digitalen Transformation im Gesundheitssystem zu geben und aufzuzeigen, was Deutschland von den Erfahrungen anderer Länder lernen kann. („#SmartHealthSystems“ o. J.)
International
Sektorenübergreifende Elektronische Gesundheitsakte in Katalonien
Die gemeinsame Gesundheitsakte in Katalonien (HC3), Història Clínica Compartida de Catalunya, wurde 2008 eingeführ. Es integriert Daten aus Krankenhäusern, Primärversorgungszentren, Langzeitpflegeeinrichtungen, psychiatrischen Einrichtungen, Notfalldiensten, Apotheken und sozialen Pflegeeinrichtungen in ein zentrales System. HC3 konsolidiert Informationen aus mehreren elektronischen Patientenakten (EMRs) unter Verwendung internationaler Standards wie HL7-CDA, SNOMED-CT und LOINC, mit einem eindeutigen Patientenidentifikator. Der Zugang ist auf zugelassene öffentliche Anbieter über ein sicheres virtuelles privates Netzwerk beschränkt, mit einem dreistufigen Sicherheitskonzept für Rückverfolgbarkeit und rechtliche Konformität. HC3 hat sich von einem einfachen Datenrepositorium zu einem strategischen Instrument für ein integriertes, patientenzentriertes Versorgungsmodell entwickelt. (Solans Fernández u. a. 2017; Solans u. a. 2018; Solans 2020; Piera-Jiménez u. a. 2024; Piera-Jiménez und Carot-Sans 2025)
Schweden
Die Studie „Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians’ job control, demand and support“ untersucht die psychosozialen Arbeitsbedingungen von Hausärzten in Schweden bei der Nutzung digitaler Konsultationen. Durch semi-strukturierte Interviews mit 28 Ärzten im Jahr 2019 wurden deren Wahrnehmungen zu Arbeitsanforderungen, Kontrolle über Arbeitsprozesse und sozialer Unterstützung analysiert, basierend auf dem Job Demand-Control-Support-Modell. Die Ergebnisse zeigen, dass Ärzte digitale Konsultationen als flexibel mit hoher Autonomie und moderaten bis niedrigen Anforderungen wahrnehmen, wobei sie Vorteile wie Zeitersparnis und Patientenzufriedenheit schätzen, aber auch Herausforderungen wie technische Probleme, Patientensicherheit und den Verlust klinischer Kompetenzen bei ausschließlich digitaler Arbeit sehen. Die Studie betont, dass digitale Konsultationen nicht Vollzeit betrieben werden sollten, um medizinische Fähigkeiten zu erhalten, und hebt die Bedeutung von sozialer Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte hervor. (Fernemark u. a. 2020)
Rumänien
Der Leitfaden “A guide to telemedicine in primary healthcare” wurde im Oktober 2022 mit technischer und finanzieller Unterstützung von UNICEF Rumänien entwickelt. Er dient als Instrument zur Unterstützung von Hausärzten und medizinischem Fachpersonal in der primären Gesundheitsversorgung, basierend auf den Bedürfnissen, die in einer Umfrage unter 100 Hausärzten ermittelt wurden. Das Ziel des Leitfadens ist es, die Organisation und Bereitstellung von Telemedizindiensten wie Telekonsultation, Telemonitoring, Teleassistenz und Teleexpertise in Rumänien zu klären, um qualitativ hochwertige und sichere Dienste zu gewährleisten und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Er wurde durch die Überprüfung relevanter internationaler Literatur und Leitlinien erstellt und an den rumänischen Rechtsrahmen angepasst.
Österreich
Die Studie „Digital Media for Primary Health Care in Austria“ untersucht den Einsatz digitaler Medien in der Primärversorgung in Österreich. Ziel ist eine patientenzentrierte und wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch organisatorische und interdisziplinäre Neuausrichtung sowie verstärkte Nutzung digitaler Technologien. Durch Literaturrecherche und eine Online-Umfrage unter österreichischen Ärzten wurden aktuelle und zukünftige Herausforderungen identifiziert, wobei Dokumentation, Kommunikation und Koordination in Arztpraxen im Vordergrund stehen. Zukünftig soll die regionale und interprofessionelle Vernetzung durch digitale Medien gefördert werden, um die Versorgungsqualität zu verbessern. (Kriegel, Tuttle-Weidinger, und Reckwitz 2017)
National Health Service Vereinigtes Königreich
Die Studie „Informing NHS policy in ‘digital-first primary care’: a rapid evidence synthesis“ untersucht digitale Kommunikationsmodelle in der Primärversorgung, bei denen der erste Kontakt eines Patienten mit einem Arzt über digitale Kanäle erfolgt. Ziel war es, NHS England durch eine schnelle Evidenzsynthese zu unterstützen, die in zwei Phasen durchgeführt wurde: zunächst eine Literaturübersicht und anschließend die Beantwortung spezifischer Fragen zu digitalen Engagement-Modellen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung digitaler Alternativen zu persönlichen Konsultationen gering ist und vor allem jüngere, weibliche, besser gebildete und einkommensstärkere Patienten diese nutzen. Es gibt Hinweise, dass Online-Triage-Tools die Nachfrage von der Primärversorgung ablenken können, jedoch variieren die Ergebnisse. Barrieren wie unzureichende NHS-Technologie und Bedenken von Mitarbeitern hinsichtlich Arbeitsbelastung und Vertraulichkeit wurden identifiziert, jedoch fehlen ausreichende empirische Daten, um diese Bedenken zu bestätigen oder zu widerlegen. (Rodgers u. a. 2019)
Das Whitepaper “The Future State of Health and Healthcare in 2035” stellt eine Vision für die zukünftige Gesundheitsversorgung in England dar, die auf evidenzbasierten Erkenntnissen basiert und von den Gründungsprinzipien des NHS geleitet wird. Dieses Dokument, das aus dem Future State Programme hervorgegangen ist und vom Gesundheitsminister Wes Streeting in Auftrag gegeben wurde, skizziert eine transformative Zukunft, in der das Gesundheitssystem nicht nur Krankheiten behandelt, sondern präventiv agiert, personalisiert ist und hohe Produktivität aufweist. Die Studie identifiziert sieben technologische Möglichkeiten – darunter integrierte Daten, die NHS App 2.0, GLP-1-Medikamente zur Bewältigung von Fettleibigkeit, tragbare Geräte, universelles Genom-Screening, KI und Robotik – die den NHS grundlegend umgestalten werden. Ziel ist es, diese bereits existierenden Technologien in grossem Massstab zu implementieren, um bis 2035 eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die sowohl effizienter als auch menschlicher ist.
Die Studie „Digital healthcare: the future“ untersucht, wie digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz, mobile Anwendungen, Wearables und Telemedizin die medizinische Versorgung in England verändern. Die Autoren beschreiben Chancen für eine bessere und individuellere Patientenversorgung, weisen jedoch auch auf Herausforderungen wie Datenschutz, Integration der Daten, Überprüfung neuer Technologien sowie die Gefahr wachsender sozialer Ungleichheiten hin. Besonders betonen sie, dass der digitale Wandel aktiv durch Ärztinnen und Ärzte begleitet werden muss, um allen Patientinnen und Patienten zugutekommen zu können. (Butcher und Hussain 2022)
Die Studie „Initial Lessons From the First National Demonstration Project on Practice Transformation to a Patient-Centered Medical Home“ untersucht die ersten Erkenntnisse aus dem ersten nationalen Demonstrationsprojekt zur Umgestaltung von Hausarztpraxen zu patientenzentrierten medizinischen Versorgungszentren (PCMH). Dabei wurden 36 familienmedizinische Praxen über zwei Jahre begleitet, um die Herausforderungen und Chancen der umfassenden Praxisveränderung zu analysieren. Die Studie zeigt, dass die Transformation weit mehr als inkrementelle Änderungen erfordert, sondern eine grundlegende Umgestaltung der Arbeitsabläufe, Teamarbeit und der ärztlichen Identität voraussetzt. Zudem werden technologische Hürden, die Gefahr von Erschöpfung durch schnellen Wandel sowie die Bedeutung lokaler Anpassungen betont. Abschließend gibt die Studie Empfehlungen für eine realistische, praxisnahe und unterstützende Umsetzung des PCMH-Konzepts. (Nutting u. a. 2009)
Der Artikel „A mixed methods formative evaluation of the United Kingdom National Health Service Artificial Intelligence Lab“ bewertet die Aktivitäten des NHS AI Lab, das 2019 mit dem Ziel gegründet wurde, den sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz im britischen Gesundheitssystem zu beschleunigen. Trotz großer Ambitionen und bedeutender Beiträge zu Politik, Regulation und Infrastruktur wurde die Umsetzung durch politische Wechsel, Budgetkürzungen und komplexe Rahmenbedingungen erschwert. Einige geförderte Projekte zeigten positive Effekte auf Behandlungsqualität und Effizienz, doch viele konnten keinen klaren wirtschaftlichen oder klinischen Nutzen nachweisen. Die Studie betont die Notwendigkeit langfristiger Koordination, realistischer Erwartungen und besserer Evaluationsmethoden, um die Potenziale von KI im Gesundheitswesen nachhaltig zu realisieren. (Cresswell u. a. 2025)
Der Bericht The NHS at a Crossroads: The App That Can Transform Britain’s Health beschreibt, wie die NHS App das britische Gesundheitssystem grundlegend modernisieren kann. Sie hebt hervor, dass die App nicht nur digitale Services bereitstellt, sondern eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung von Patientenversorgung und klinischen Wegen spielen kann. Mit über 40 Millionen Downloads ermöglicht die App den Zugang zu GP-Daten, Bestellungen von Rezepten und Terminmanagement. Der Bericht betont, dass eine stärkere politische Priorisierung, gezielte Investitionen und eine Integration in nationale Behandlungsprozesse notwendig sind, damit die NHS App ihr volles Potenzial entfalten kann.
Kann eine Handy-App ein zentrales Informationsmittel im Gesundheitssystem sein? Gibt es in Deutschland ähnliche Ansätze wie die NHS-App? Welche bestehenden Apps in Deutschland kommen einem zentralen Informationsmittel nahe (116117.app)? Welche Funktionen müsste eine Handy-App haben, um als zentrales Bindeglied für Patienten im Gesundheitssystem effektiv zu sein?
Das Topol Digital Fellowships-Programm, Teil der NHS Digital Academy, unterstützt Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen mit Zeit, Schulungen und Mentoring, um digitale Transformationsprojekte in ihren Organisationen zu leiten. Es vermittelt Fähigkeiten wie personenzentriertes Design, agile Projektmethoden und den Einsatz von Daten für die Dienstleistungsgestaltung. Durch Workshops und den Austausch mit Experten und Gleichgesinnten werden Fellows inspiriert, innovative digitale Gesundheits- und Pflegedienste zu entwickeln. Das Programm richtet sich an klinisches und nicht-klinisches Personal in England, das die digitale Revolution im Gesundheitswesen vorantreiben möchte. In Partnerschaft mit Health Innovation Wessex bietet es eine Plattform für nachhaltige digitale Innovationen.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Die Studie mit dem Titel „Adoption of artificial intelligence in healthcare: survey of health system priorities, successes, and challenges“ untersucht die Verbreitung und Erfolgsfaktoren von Künstlicher Intelligenz (KI) in US-Gesundheitssystemen im Zeitalter der generativen KI. Dabei zeigt sich, dass insbesondere das Tool „Ambient Notes“ zur automatisierten klinischen Dokumentation großflächig eingeführt wurde und als erfolgreich bewertet wird. Andere Anwendungsbereiche wie Bildgebung und Risikostratifizierung sind ebenfalls verbreitet, erreichen aber nur mäßige Erfolge. Als zentrale Hindernisse für die KI-Adoption werden vor allem die Unreife der Technologien, finanzielle Bedenken und regulatorische Unsicherheiten genannt. Die Studie betont die Notwendigkeit gemeinsamer Strategien und regelmäßiger Evaluationen, um den Einsatz von KI im Gesundheitswesen sicher und effektiv zu gestalten. (Poon u. a. 2025)
Die Studie mit dem Titel „The State of Remote Patient Monitoring for Chronic Disease Management in the United States“ beschreibt die rasante Zunahme der Fernüberwachung von Patientendaten (Remote Patient Monitoring, RPM) in den USA, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie. Sie zeigt, dass RPM die Kontrolle chronischer Erkrankungen verbessert, indem Gesundheitsdaten von außerhalb der Klinik erfasst und an medizinische Fachkräfte übertragen werden. Vorteile sind u.a. bessere Medikamenteneinhaltung, weniger Notaufnahmebesuche und höhere Zufriedenheit bei Patienten und Ärzten. Die Studie thematisiert auch Herausforderungen wie die Integration der Daten in die klinischen Abläufe, Zugangsschranken, Regulierung, Erstattung und notwendige politische Maßnahmen für eine nachhaltige Nutzung von RPM im Gesundheitssystem. Dabei spielt gerechter Zugang und wirtschaftliche Tragfähigkeit eine zentrale Rolle. (Paul u. a. 2025)
Afrika
Der Artikel „How digital transformation can accelerate data use in health systems“ untersucht die Digitalisierung von Gesundheitssystemen in fünf afrikanischen Ländern: Burkina Faso, Äthiopien, Malawi, Südafrika und Tansania. Ziel ist es, ein ganzheitliches Modell für die digitale Transformation zu entwickeln, das die wesentlichen Erfolgskomponenten und deren Wechselwirkungen identifiziert. Die Studie zeigt, dass erfolgreiche Digitalisierungsbemühungen über Systeme und Werkzeuge hinausgehen und Aspekte wie Stakeholder-Engagement, Gesundheitsfachkräfte-Kapazitäten und Governance-Strukturen berücksichtigen. Zwei neue kritische Komponenten wurden hervorgehoben: die Förderung einer Datennutzungskultur und das Management systemweiter Verhaltensänderungen. Das Modell bietet evidenzbasierte Strategien für Regierungen, Politikgestalter und Geldgeber, um die Datennutzung in Gesundheitssystemen zu verbessern. (Werner u. a. 2023)
China
Die Studie „The Landscape of Medical AI in China“, veröffentlicht in NEJM AI im Juni 2025, untersucht den aktuellen Stand und die Entwicklung von medizinischer KI in China. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass China in den letzten zwei Jahren die USA in der Anzahl medizinischer KI‑Publikationen überholt hat, wobei der Schwerpunkt vor allem auf technischer Entwicklung liegt. Wichtige Akteure sind die Chinesische Akademie der Wissenschaften sowie führende Universitäten mit angeschlossenen Spitzenkrankenhäusern. Trotz wachsender staatlicher Förderung, besserem Zugang zu Rechenressourcen und einer optimierten Regulierungsstruktur bestehen weiterhin Herausforderungen, wie fragmentierte Datenquellen und eine eingeschränkte Integration von KI in den klinischen Alltag. (Qiu u. a. 2025)
Australien
Im Mai 2017 empfahl der Bericht des Victorian Auditor-General, ICT Strategic Planning in the Health Sector, eine umfassende Bewertung der klinischen IKT-Reife, um Investitionsentscheidungen gezielt auf die dringendsten Bedürfnisse im Gesundheitswesen auszurichten. In Reaktion darauf entwickelte das Gesundheitsministerium Victorias Digital Health Maturity Model (VDHMM), das speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheitsdienstleister Victorias zugeschnitten ist. Das Modell umfasst neun Säulen und wurde 2018 in Zusammenarbeit mit Ernst and Young Victoria’s Digital Health Maturity Model: a progressive framework of digital health technology adoption entwickelt. Eine unabhängige Evaluierung durch die Deakin University (2020) bestätigte, dass das Modell umfassend, für Victorias Gesundheitsdienste geeignet und überregional anwendbar ist. Seit 2019 werden alle zwei Jahre Bewertungen durchgeführt, deren Ergebnisse die Investitionsplanung im Gesundheitswesen unterstützen. (Davies 2023; Nguyen u. a. 2024)
Die Studie „A Digital Health Maturity Assessment for General Practice“ untersucht die digitale Reife von Allgemeinpraxen in der Region Gippsland. Im Rahmen des „One Good Community“-Programms führte das Gippsland Primary Health Network (PHN) im März 2020 eine Bewertung durch, um die technische, kulturelle und veränderungsbereite Ausgangslage der Praxen zu analysieren. Mit 47 Fragen wurden Themen wie Infrastruktur, Fähigkeiten und Bereitschaft zur Einführung neuer Versorgungsmodelle abgedeckt, wobei 74 von 81 Praxen (91,4 %) teilnahmen. Die durchschnittliche Punktzahl lag bei 65,1 von 100, mit Stärken in der Infrastruktur (74,5) und Schwächen in den Fähigkeiten (52,0). Die Ergebnisse zeigen unter anderem veraltete Technologien wie Faxgeräte, eine geringe Nutzung von Telehealth und ein großes Interesse an neuen digitalen Versorgungsmodellen. Diese Erkenntnisse ermöglichen maßgeschneiderte Unterstützung durch Gippsland PHN, um die digitale Transformation der Praxen zu fördern. (Azar u. a. 2020)
Veranstaltungen
Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.